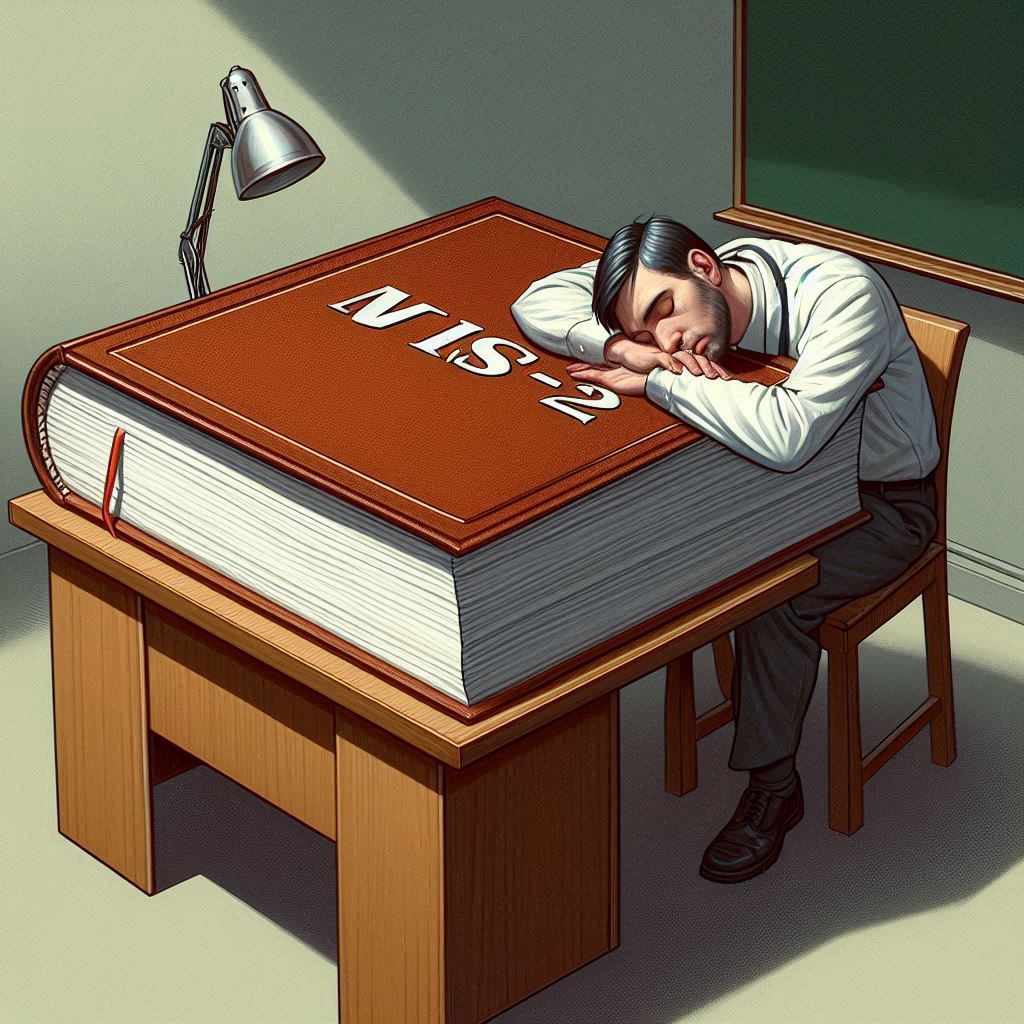Warten ist keine Strategie: NIS-2 fordert jetzt Taten, nicht Ausreden!
Warten ist keine Strategie NIS-2 fordert jetzt Taten, nicht Ausreden! Die NIS-2-Richtlinie (Network and Information Security Directive 2) ist die überarbeitete Version der ursprünglichen NIS-Richtlinie. Sie soll die Cybersicherheit in Europa weiter stärken und bringt insbesondere für kritische und wichtige Sektoren deutlich verschärfte Anforderungen mit sich. In diesem Artikel erfährst du, auf welche Themen sich … Weiterlesen